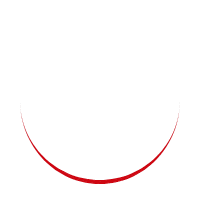Wie weiter nach einer RA-Diagnose? Der folgende Auszug aus der Broschüre «Rheumatoide Arthritis. Leben mit einer chronischen Erkrankung» zeichnet den Weg vor, den Sie zur medikamentösen Behandlung einschlagen und auf dem Sie in eine aktive Rolle hineinwachsen, um die Krankheit zu managen. Die Empfehlungen gelten sinngemäss auch für andere chronisch-entzündliche Rheumaerkrankungen.
Bis zur ärztlichen Diagnose einer rheumatoiden Arthritis kann es vor allem bei jungen Betroffenen vorkommen, dass
sie als überempfindlich oder gar als Simulantinnen bzw. Simulanten
wahrgenommen werden. Das ist nicht verwunderlich: Eine Entzündung am Gelenk sieht
häufig wie eine Prellung oder eine Verstauchung aus. Im Unterschied dazu nimmt
der Schmerz bei einer unbehandelten rheumatoiden Arthritis allerdings zu, nicht
ab.
Typischer Gelenkentzündungsschmerz
Generell ist das Schmerzempfinden individuell sehr verschieden. Dennoch werden Sie mit zunehmender Erfahrung lernen, den Schmerz einer rheumatoiden Arthritis als einen klaren Gelenkentzündungsschmerz zu identifizieren. Die Unterscheidung von anderen Schmerzen ist wichtig, weil der typische Gelenkentzündungsschmerz später auch einen drohenden Rückfall frühzeitig anzeigen kann.
Ich habe RA. Und was jetzt?
Den Moment der Diagnose nehmen viele Betroffene als schweren Einschnitt in ihr Leben wahr. Ereignisse werden ab dann in eine Zeit vor und eine Zeit nach der Diagnose eingeordnet. Gerade als junger Mensch kann man versucht sein, die Diagnose RA und deren drohende Beeinträchtigung auf das Leben erst einmal zu verleugnen.
Wurde die Diagnose hingegen spät gestellt, haben sich Betroffene möglicherweise bereits mit einer gewissen Einschränkung der Lebensqualität abgefunden. Sie sind vielleicht sogar erleichtert, dass die Beschwerden endlich einen Namen haben. Doch gilt es nun zu akzeptieren, dass die Einschränkungen möglicherweise von Dauer sein werden.
Die RA akzeptieren und nicht resignieren
Die Phase der Erkenntnis bis zur Annahme der Diagnose ist individuell und kann unter Umständen sehr lange dauern. In dieser Zeit stürzt vieles auf einen ein. Man wird mit Informationen von Seiten des medizinischen Fachpersonals eingedeckt und erhält oft, auch unaufgefordert, Aufmerksamkeit durch das soziale Umfeld.
Die persönliche Reaktion auf die Diagnose hängt vom individuellen Charakter ab, aber auch von der Stärke der Beschwerden und der Zeitdauer von den ersten auffälligen Schmerzen bis hin zum Moment der Diagnose. Denken Sie daran: Die RA zu akzeptieren, bedeutet nicht, im Kampf dagegen zu resignieren. Im Gegenteil: Es bedeutet, dass Sie versuchen, das Beste aus der Situation zu machen.

Gemeinsam zur richtigen Medikation
Wichtig ist, dass Sie sich nach gesicherter Diagnose zusammen mit Ihrer Rheumatologin oder Ihrem Rheumatologen auf Ihre individuelle Situation konzentrieren. Auf medizinischer Ebene hat die Einstellung einer wirksamen und verträglichen medikamentösen Therapie Priorität. Alle direkt damit verbundenen Schritte sind sinnvoll, da diese Sie in absehbarer Zeit von den akuten Schmerzen befreien sollen.
Bis das für Sie das richtige Medikament oder die richtige Medikamentenkombination gefunden ist, kann es eine Weile dauern, während der Sie je nach Medikament auch mit Nebenwirkungen leben müssen. Die Geduld lohnt sich, denn die ersten medikamentösen Therapieerfolge bringen den Optimismus und die Hoffnung auf einen positiven Krankheitsverlauf mit sich. Vertrauen Sie dem Team, das Sie zusammen mit Ihrer Rheumatologin oder Ihrem Rheumatologen bilden.
Versuchen Sie, sich während dieser Zeit nicht von Tipps aus dem Internet oder gutgemeinten Ratschlägen von Bekannten beeinflussen zu lassen. Sie setzen damit möglicherweise die grundsätzlich guten Erfolgschancen der medikamentösen Behandlung aufs Spiel. Eine Erkrankung wie die rheumatoide Arthritis lässt sich nicht durch einfaches Vermeiden von Umwelteinflüssen heilen, auch nicht durch das Einhalten spezieller Diätformen. Auch wenn die richtige Ernährung durchaus Bestandteil einer umfassenden RA-Therapie sein kann.
Vertrauensvolle Beziehung auf Augenhöhe
Die Interaktion zwischen Ihnen und Ihrer Ärztin respektive Ihrem Arzt
erschöpft sich nicht in medizinischen Leistungen. Gerade bei der
rheumatoiden Arthritis sind auch immer wieder sehr persönliche
Gespräche nötig, damit die richtigen Entscheidungen in Bezug auf die
Therapie getroffen werden können.
Sie sollten sich von den Sie betreuenden Fachpersonen ernst genommen und mitsamt Ihren Charaktereigenschaften akzeptiert fühlen. Der passende Rheumatologe oder die passende Rheumatologin sollte fähig sein, Sie immer wieder an die Prioritäten zu erinnern und mit soliden fachlichen Argumenten von den nötigen Therapiemassnahmen zu überzeugen.
Gleichzeitig sollte diese Person verstehen, dass Sie nicht nur Patientin oder Patient sind, sondern ein normaler Mensch, der seiner Krankheit nicht das ganze Leben unterordnen will.
Therapieentscheide gemeinsam treffen
Die wirksamste Therapie ist meistens jene, die am besten in das individuelle Leben der von RA betroffenen Person passt. Und nicht zwingend jene, die aus der Sicht wissenschaftlicher Studien empfohlen wird. Aus einem vertrauensvollen Austausch auf Augenhöhe zwischen Ihnen und Ihrer Ärztin bzw. Ihrem Arzt entstehen gute Therapieentscheide fast automatisch.
Werden neue Therapien ausprobiert oder ergänzend hinzugefügt, kann es immer wieder zu Misserfolgen kommen. Deshalb ist es wichtig, dass Sie und Ihre Ärztin oder Ihr Arzt die relevanten Entscheidungen gemeinsam treffen. Dadurch werden falsche Erwartungen vermieden und die Frustration im Fall von Rückschlägen gedämpft.
Eine Therapie, von deren Wirkung Sie überzeugt sind, ist meist erfolgreicher als eine, an der sie zweifeln. Das ist wissenschaftlich erwiesen. Geben Sie den Sie betreuenden Fachpersonen eine Chance, Ihre Zweifel wahrzunehmen und im Gesamtrahmen richtig einzuordnen.
Führen Sie Buch über Ihre Erkrankung
Auch im Zeitalter der zunehmenden Digitalisierung von Patientendaten gibt es immer wieder Situationen, in denen man mit medizinischen Fachpersonen in Kontakt kommt, die keinen oder nur einen lückenhaften Zugang auf die eigene Krankengeschichte haben. Das kann sein beim Eintritt in ein Spital, bei einem Arztwechsel oder auch während einer Reise. Solche Informationslücken können zu Behandlungsfehlern, Doppelbehandlungen oder auch der Verabreichung schlecht tolerierter Medikamente führen.
Es bringt viele Vorteile, wenn Sie Ihre Krankheit selber mitverwalten. Hilfreich ist es, wenn Sie ein eigenes Dossier erstellen mit relevanten Dokumenten, Analyseresultaten, festgestellten Unverträglichkeiten und bereits vollzogenen Behandlungsschritten.
Checkliste für Ihr persönliches Patientendossier
- Aufklärungsbroschüren und Informationsblätter
- Liste aller aktuellen und früheren Medikamente, inkl. Dosierungen, Nebenwirkungen
- Beipackzettel der aktuellen Medikamente
- Röntgen- und Ultraschallbilder
- Ärztliche Diagnose-, Überweisungs- und Austrittsberichte
- Informationen zu allfälligen weiteren Krankheiten sowie bekannten Allergien oder Unverträglichkeiten
- Impfpass und Blutgruppenausweis
Quelle: Rheumaliga Schweiz (Hrsg.): Rheumatoide Arthritis. Leben mit einer chronischen Erkrankung, Zürich 2020, S. 26-32